von: Isabel Friedli
Nach dem Schnee
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Erscheinungsweise der Arbeiten gewandelt, wobei sich das zugrundeliegende Konzept und die Vorgehensweise der Künstlerin nicht massgeblich verändert haben. Ihr Arbeitsmaterial sind Abbildungen von zeitgenössischen Kunstwerken, aber auch von anderen bildnerischen Gefügen, die sie aus einem bestimmten Grund interessieren und faszinieren. Fankhauser findet ihre Motive in Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen und Büchern. Ein wesentliches Merkmal dieses Rohmaterials ist also, dass die Formen und Bilder schon als Reproduktionen vorliegen und somit bereits „sekundäre Ansichten“ sind, wenn sie von der Künstlerin aufgegriffen und weiter verwandelt werden. Sie sammelt die Motive, löst sie aus ihrem ursprünglichen Kontext und isoliert sie – in der Chemie würde man von Extraktion sprechen –, indem sie die Bilder in den Computer einspeist. Einmal Teil des Inventars, generiert sie daraus rechnerische Derivate, die sie so umformt und reduziert, bis sich so etwas wie der Kern, das Bildgerüst oder die molekulare Struktur herauskristallisiert, die sie dann neu zusammensetzt und kombiniert. Im Laufe der Zeit hat sich so ein umfassendes Archiv ergeben aus Bildern, die durch die Reproduktion bereits vom Sog der Aneignung erfasst worden sind. Es ist ein Kompendium entstanden, ein Musterbuch oder ein eigenständiger Katalog buchstäblich „freigestellter“ Bildformeln – das Alphabet der Bildsprache von Susanne Fankhauser.
Massgebend für die Auswahl – und ich zitiere hier Roman Kurzmeyer - ist „die künstlerische Zielsetzung, in der neuen Kombination möglichst interessante Konfigurationen zu schaffen (...). Verzerrungen und Entstellungen, wie sie durch die photographischen Reproduktionen entstehen, sieht die Künstlerin nicht als Fehler oder Differenz zur Vorlage, sondern im Gegenteil als das, was diese tatsächlich auch sind: Formen. Die Reproduktion verweist bei (...) diesen Arbeiten nicht zurück auf ein Original. Die Reproduktion ist das Original, das die Künstlerin als Form interessiert“ . Der Ausstellungsmacher Roman Kurzmeyer bezieht sich in der zitierten Stelle auf die frühen Werke der Künstlerin, in denen sie ausschliesslich mit Reproduktionen von dreidimensionalen Kunstwerken arbeitete, die in der Wiederverwendung als solche noch zu erkennen waren wie schemenhafte Nachbilder auf der Netzhaut oder Umrisse von Erinnerungsbildern. Die jüngeren Arbeiten, die hier gezeigt werden, haben sich von diesem Spiel mit der Wiedererkennbarkeit und der Orchestrierung bekannter Instrumente weitgehend verabschiedet. Sie sind sehr viel radikaler und knapper und spitzen das Verfahren auf die Treffsicherheit von Piktogrammen zu, die aber viel stärker auf der Seite der Sinnlichkeit als der Funktionalität agieren.
Die geschilderte Vorgehensweise lässt an Sampling denken, eine Praxis, die in der Popkultur eine längere Tradition hat. Sequenzen eines Musikstücks werden neu montiert und ergeben eine Melodie, welche frisch und doch vertraut klingt, weil sie sich aus einer Quelle speist, die als Urmelodie zu erahnen bleibt. Dieses Verfahren ist in der Kunstgeschichte als Appropriation Art diskutiert worden. Appropriation heisst Aneignung, das künstlerische Vorgehen ist, Dinge und Objekte aus ihrem angestammten Zusammenhang zu entwenden und mithilfe der Fotografie neu zu verwenden. Berühmte Künstler der Appropriation Art sind etwa Richard Prince oder Louise Lawler, die das Prinzip der „Re-Photography“, der „Wieder-Fotografie“ oder „Abfotorgrafie“, als künstlerische Praxis eingeführt haben. Diesen Künstlern ist aber gemeinsam, dass sie die übernommene Sache nur marginal weiter verarbeiten. Sie fügen sie nahezu unverändert in einen neuen Kontext ein wie Raubgut aus einem diebischen Beutezug. Den Arbeiten von Susanne Fankhauser fehlt aber in jüngster Zeit dieser Aspekt der räuberischen Piraterie, die Elemente der Bildbestandteile ihrer Kunst sind nicht als solche erkennbar wie berühmte gestohlene Diamanten, die leicht identifiziert werden können. Wenn wir im Bild bleiben möchten, sind es neue Gebilde, die aus eingeschmolzenem Altgold gegossen werden. Die Bildelemente verbinden sich in der Montage zu einer neuen Einheit, die als selbstständiges Gebilde wahrgenommen wird. Es geschieht eine Verwandlung – eine Metamorphose. Im Einschluss in der neuen Komposition verlieren die aus ihrem Kontext gelösten Einzelteile ihren selbstständigen bildhaften Charakter und mutieren durch die Digitalisierung zu Codes. Auf diesen Aspekt der Zeichenhaftigkeit – ein Code ist ein Zeichen – möchte ich später noch einmal zurückkommen.
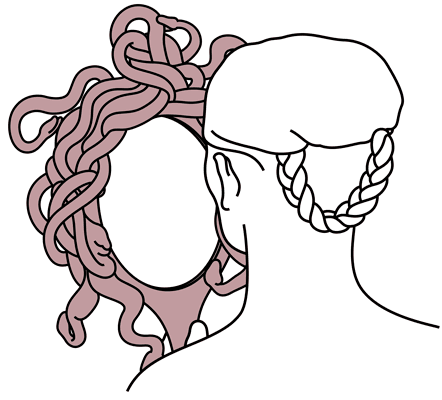
Der Begriff Metamorphosen scheint im übrigen nicht zu weit hergeholt, stammen doch nicht wenige der Bestandteile aus einem bildnerischen Umfeld, das eine Begebenheit aus der griechischen Mythologie darstellt. Das werden sie feststellen können, wenn sie sich im Raum 5 etwa das Bild ENGEL oder LOOKING GLASS anschauen. Der Haarkranz um den Spiegel in LOOKING GLASS erinnert an Caravaggios berühmtes Bild in den Uffizien in Florenz, das auf einem Tondo das abgeschlagene Haupt der Medusa zeigt. Die Sage geht, dass der Anblick dieser grässlichen Gestalt jeden vor Grauen sofort zu Stein erstarren liess. Es war der junge Held Perseus, dem es mit einer List gelangt, die Medusa zu töten, und zwar mithilfe eines Schildes, den er von der Göttin Athena geschenkt bekommen hatte. Der glänzend polierte Schild reflektierte so stark, dass die Medusa als Spiegelbild darin sichtbar wurde, unser Held den direkten Blickkontakt mit dem Ungeheuer vermeiden und ihm mit einem Schwert den Kopf abschlagen konnte. Gerade noch sind im Bild LOOKING GLASS von Susanne Fankhauser die Schlangenköpfe erkennbar, die um das Haupt der furchterregenden Medusa züngeln. Auch der Spiegel kehrt wieder, eine Frau steht davor, wir sehen aber nicht ihr Spiegelbild, sondern eine leere Fläche. Die griechische Mythologie rauscht auch durch das Bild ENGEL, die Flügel des in der Hocke kauernden Jungen sind eine Reminiszenz an die Schwingen von Pegasus, dem geflügelten Pferd, das vom Meeresgott Poseidon mit der Gorgone Medusa gezeugt wurde. Es wird berichtet, dass Pegasus dem Nacken der Medusa entsprungen ist, nachdem diese von Perseus geköpft worden war. Aber all dies sind andere Geschichten, die ein andermal erzählt werden müssen.
In ihren frühesten Arbeiten hat Susanne Fankhauser stärker räumlich und installativ gearbeitet. Diese Bilder waren von einer Opulenz geprägt, die in den jüngeren Arbeiten einer grösseren Einfachheit gewichen ist. 
In den Arbeiten im unteren Stockwerk ist diese ausgesprochene Dichte und Vielteiligkeit noch sichtbar, etwa in HAPPY NEW YEAR (2007): Dieses Bild ist eine Übergangsform aus den älteren Arbeiten, bei denen die Künstlerin die Abbildungen dreidimensionaler Kunstwerke fast immer vollständig wiedergegeben und das Quellenmaterial in einer Bildlegende benannt hat. In HAPPY NEW YEAR zeichnen sich die neuen Tendenzen ab: Die Künstlerin arbeitet mit Bildfragmenten und erlaubt sich eine grössere Kombinationsfreiheit. HAPPY NEW YEAR wirkt als Bild wie ein verwüstetes Festbankett: Grüne Erbsen liegen am Boden, ein monströses Schwein mit grüner Schleife ist dabei, die achtlos verstreuten Feldfrüchte zu verzehren. Ein Kronleuchter, behangen mit allerlei Tand, beherrscht den Bildraum. Vorne links steht ein Kind, engelsgleich und übergross, sein Tun konzentriert sich auf eine Zone ausserhalb des Bildraums. Es herrscht ein drunter und drüber aus Farbe und Form, gross und klein, vorne und hinten. Und doch ist das Bild aufgeräumt. Kind und Schwein sind Übernahmen aus einer Abbildung der Skulptur USHERING IN BANALITY (1988) des amerikanischen Künstlers Jeff Koons. Der Kronleuchter ist der Installation DUSTED BY RICH MANOEUVRE (2001) von Suzann Victor entnommen. Fankhausers Bild RABENELTERN aus dem Jahr 2007 zeigt ein barockes Gefüge, das an ein blutiges Schlachtfeld erinnert.
 Zwei Raben hocken auf einer Schüssel Eier, die sie offenbar mit ihrem Schnäbeln zerhackt haben. Rote Farbspritzer an den Wänden der Raumecke lassen an Blut denken. Das Ei, schützende Keimzelle für neues Leben, ist grausam und absichtsvoll zerstört. Die Schüssel mit den Eiern stammt aus Marcel Broodthaers Werk UN PLAT DE FAYENCE D’OEUFS BLANCS. Vielleicht wegen der Schüssel denkt man bei dem Bild an Topoi aus der christlichen Ikonographie wie „Salome mit dem Haupt des Johannes“ oder an „Judith und Holofernes“. Dem Bild haftet auch etwas Märchenhaftes an. Man denkt an Hänsel und Gretel oder an das oft grausame Treiben im göttlichen Olymp, an Vater- und Muttermord, an Shakespeare. In seiner konzeptuellen, fast geometrischen Anlage entzündet das Bild eine Stimmung, die mit der linearen, flächigen und dadurch kühl wirkenden Struktur kontrastiert. Dieser erste Raum verweist also auf die Anfänge des Werks von Susanne Fankhauser. Unschwer vorzustellen, dass sie von der Wandmalerei herkommt, von der Kunst am Bau also, von der grossen Fläche, der Bespielung des Raums, der Konfrontation mit der Architektur. Und auch heute noch sind die Motive ihrer Drucke eigentlich die Vorlagen für die direkt auf die Wand applizierte Ausführung. Eine Tendenz zur Reduktion, zur Vereinfachung und Verknappung ist dann aber schon in den anderen Werken im Raum des Erdgeschosses abzulesen. In PUSTEBLUMEN zum Bespiel.
Zwei Raben hocken auf einer Schüssel Eier, die sie offenbar mit ihrem Schnäbeln zerhackt haben. Rote Farbspritzer an den Wänden der Raumecke lassen an Blut denken. Das Ei, schützende Keimzelle für neues Leben, ist grausam und absichtsvoll zerstört. Die Schüssel mit den Eiern stammt aus Marcel Broodthaers Werk UN PLAT DE FAYENCE D’OEUFS BLANCS. Vielleicht wegen der Schüssel denkt man bei dem Bild an Topoi aus der christlichen Ikonographie wie „Salome mit dem Haupt des Johannes“ oder an „Judith und Holofernes“. Dem Bild haftet auch etwas Märchenhaftes an. Man denkt an Hänsel und Gretel oder an das oft grausame Treiben im göttlichen Olymp, an Vater- und Muttermord, an Shakespeare. In seiner konzeptuellen, fast geometrischen Anlage entzündet das Bild eine Stimmung, die mit der linearen, flächigen und dadurch kühl wirkenden Struktur kontrastiert. Dieser erste Raum verweist also auf die Anfänge des Werks von Susanne Fankhauser. Unschwer vorzustellen, dass sie von der Wandmalerei herkommt, von der Kunst am Bau also, von der grossen Fläche, der Bespielung des Raums, der Konfrontation mit der Architektur. Und auch heute noch sind die Motive ihrer Drucke eigentlich die Vorlagen für die direkt auf die Wand applizierte Ausführung. Eine Tendenz zur Reduktion, zur Vereinfachung und Verknappung ist dann aber schon in den anderen Werken im Raum des Erdgeschosses abzulesen. In PUSTEBLUMEN zum Bespiel.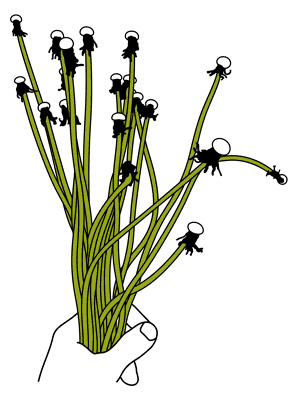 Der sprichwörtliche Bildersturm ist vorbeigezogen und hat die Flugsamen der Löwenzahnblüten zerstäubt. Was bleibt, sind die nackten Stängel ohne „Federbusch“ in einer Hand, die sie hält. Auch DAS VERLORENE EI taucht wieder auf, allerdings als sorgfältig in der Schwebe gehaltene Membran, die das Innere geborgen hält. Mir scheint, dass durch diese Vereinfachung die Frage nach dem Ursprung der Bildbestandteile zusehends unwesentlich wird und sich gleichzeitig so etwas wie ein eigenständiges Wesen der Bildfindung herausbildet, das in den Bildern in den Räumen im oberen Stockwerk ablesbar wird. „Die Aufmerksamkeit wird auf die rätselhaft vereinzelten Bildmotive gelenkt, die jetzt vermehrt um Themen der Körpersprache, mentale Befindlichkeiten und Affektivität kreisen“. Meine Behauptung ist also, dass die Bilder durch die Reduktion zwar minimaler wirken, gleichzeitig aber das Potential in sich bergen, die Imagination des Betrachters zu befeuern. Es ist wie in der Traumarbeit, die nach Freud ja auch mit den Mechanismen der Verschiebung und Verdichtung arbeitet: Der latente Trauminhalt kommt zum Vorschein, wenn der Träumer über die kryptisch wirkende konkrete Traumbeschaffenheit nachdenkt. Dazu passt das Zitat des japanischen Schriftstellers Murakami Haruki, das von der Künstlerin für die Einladungskarte zu dieser Ausstellung ausgewählt wurde: „Tag für Tag habe ich alte Träume gelesen, die ganze Zeit über, doch verstanden habe ich kein Fitzelchen, das Sinn gemacht hätte. (...)“
Der sprichwörtliche Bildersturm ist vorbeigezogen und hat die Flugsamen der Löwenzahnblüten zerstäubt. Was bleibt, sind die nackten Stängel ohne „Federbusch“ in einer Hand, die sie hält. Auch DAS VERLORENE EI taucht wieder auf, allerdings als sorgfältig in der Schwebe gehaltene Membran, die das Innere geborgen hält. Mir scheint, dass durch diese Vereinfachung die Frage nach dem Ursprung der Bildbestandteile zusehends unwesentlich wird und sich gleichzeitig so etwas wie ein eigenständiges Wesen der Bildfindung herausbildet, das in den Bildern in den Räumen im oberen Stockwerk ablesbar wird. „Die Aufmerksamkeit wird auf die rätselhaft vereinzelten Bildmotive gelenkt, die jetzt vermehrt um Themen der Körpersprache, mentale Befindlichkeiten und Affektivität kreisen“. Meine Behauptung ist also, dass die Bilder durch die Reduktion zwar minimaler wirken, gleichzeitig aber das Potential in sich bergen, die Imagination des Betrachters zu befeuern. Es ist wie in der Traumarbeit, die nach Freud ja auch mit den Mechanismen der Verschiebung und Verdichtung arbeitet: Der latente Trauminhalt kommt zum Vorschein, wenn der Träumer über die kryptisch wirkende konkrete Traumbeschaffenheit nachdenkt. Dazu passt das Zitat des japanischen Schriftstellers Murakami Haruki, das von der Künstlerin für die Einladungskarte zu dieser Ausstellung ausgewählt wurde: „Tag für Tag habe ich alte Träume gelesen, die ganze Zeit über, doch verstanden habe ich kein Fitzelchen, das Sinn gemacht hätte. (...)“
Es gehört zu den kraftvollen Merkmalen dieser Werke, dass sie einen dazu aufrufen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen, was sie eigentlich zeigen. Es sind Codes, bildhafte Zeichen, die auf visueller Ebene kommunizieren. Diese Zeichen haben aber nun – und das ist tückisch, macht aber die Wandelbarkeit und Lebendigkeit eines Zeichensystems aus – zwei Seiten, oder zwei Wertigkeiten. Es geht zu und her wie im Schulbuch semiotischer Zeichenlehre, in der das Bezeichnende und das Bezeichnete – Signifikat und Signifikant – die zwei Seiten einer Münze sind, die man nie gleichzeitig sieht. Die sich ständig umeinander drehen, ohne aber zur Deckung zu gelangen. Dabei wäre die Festlegung einfach: Zeichen stehen in einer speziellen Beziehung zu etwas anderem. Von einem Zeichen ist zu sprechen, wenn etwas für etwas anderes steht. Platzhalter also. Das höchstentwickelte Zeichensystem ist die menschliche Sprache. Sie macht die ganze sinnlich wahrnehmbare Welt verfügbar, ohne dass die Dinge der Welt physisch anwesend sein müssen. Grundsätzlich kann also alles durch ein Zeichen bezeichnet werden.
Nun ist es aber so, dass die vermeintlich unverrückbaren Grundbestandteile etwa der menschlichen Sprache, diese klaren, von allen akzeptierten Festlegungen, in Wahrheit ständig abrutschen und das sprachliche Bild verunklären. Das Wort „Heimat“ etwa hat für jeden Menschen eine individuell gefärbte Bedeutung und löst andere Vorstellungen aus. Der Stamm mag zwar wenig differieren. Welche affektiven, durch die persönliche Geschichte und Sozialisierung geprägten Verästelungen der Begriff aber ausweist, ist nicht zu kontrollieren. Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera listet in seinem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ ein Verzeichnis der unverstandenen Begriffe auf, die für seine Protagonisten Sabina und Franz abweichende Bedeutungen haben und zu Ungereimtheiten führen. Es sind Motive, die immer wiederkehren und jedes Mal eine andere Bedeutung haben. „All diese Bedeutungen durchströmen den Begriff wie das Wasser das Flussbett“, schreibt Kundera. Zwar verstehen wir „die Bedeutung der Wörter (...), doch das Rauschen des semantischen Flusses“ kann man nicht hören. Dann schickt der Autor doch noch einen tröstlichen Gedanken nach: „Derselbe Gegenstand ruft jedes Mal eine andere Bedeutung hervor, aber alle vorangegangenen Bedeutungen sind in der neuen Bedeutung zu hören wie ein Echo, wie eine Folge von Echos“.
Was hat das nun aber mit den Bildern von Susanne Fankhauser zu tun? Formal gesehen sind auch sie so stark reduziert, dass sie einem Grenzwert entgegenzustreben scheinen, Richtung Verknappung, dem Stellenwert eines Codes, einer Festlegung, einem Bilderkanon entgegen. Ikone würde man in der Zeichenlehre sagen. Mit der Ikonenmalerei, um hier einen kühnen Spagat zu wagen, spielt ja ein Bild wie BIRD im Raum 4 auf diesem Stockwerk. Auf einer golden grundierten Holztafel zeigt es eine Hand mit einem ausgestreckten Zeigefinger, worauf ein scheuer Vogel sitzt. Das Bild bezieht seine auratische Wirkung auch aus dem Goldgrund, der seit der byzantinischen Ikonenmalerei auf das All verweist, auf die Unverbundenheit des dargestellten göttlichen Geschehens mit dem irdischen Raum, der die Kommunikation des profanen Betrachters mit dem Heiligen ermöglicht. Diese Öffnung: Sie findet sich auch in den Bildern von Susanne Fankhauser und ermöglicht hier eine Vielheit von Bedeutungen. Das ist – neben dem Nominalwert auf der einen Seite, der den Nennwert angibt - die assoziative Seite der Münze, die nicht auf eine eindeutige Zuweisung einer einzigen inhaltlichen Interpretation beharrt, sondern zeigt, das die Bilder ästhetisch geschnürte Pakete sind, die beim Öffnen einen Schmetterlingsschwarm an Bedeutungen loslassen.
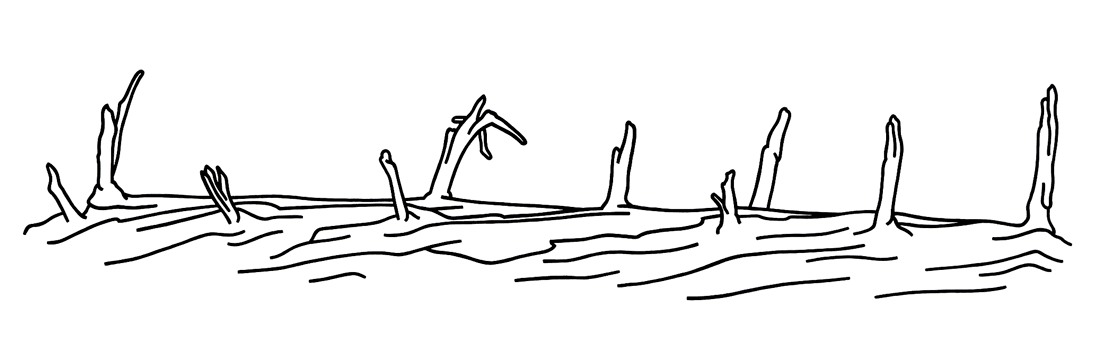 Eine letzte Bildbeschreibung. NACH DEM SCHNEE ist der Titel einer neuen Arbeit, die hier im Raum hängt: Das Bild zeigt einen liegenden Baumstamm, der aufs Äusserste reduziert dargestellt ist. Eine Umrisslinie markiert die obere Kante des Stamms, die untere Begrenzung ist nicht sichtbar. Einige stumpfe Äste ragen nach oben, blattlos und kahl wie die Knochen eines Gerippes. Linien im Innern verweisen auf die Struktur der Rinde. Ein kahler Baumstamm, der lange überwinterte im dicken Schneefell des Winters. So sparsam die zeichnerischen Indikatoren sind, so deutlich können wir die visuelle Sprache entziffern: Das ist ein Baumstamm. Seltsam unverortet liegt er im weissen Raum des Blattes. Dieses Weiss scheint unendlich zu sein, und es bedeutet vieles und nichts. Fast scheint es so, als ob sich der Baumstamm vor unseren Augen bewegte: Entweder er verschwindet oder er kommt langsam zum Vorschein aus dem weissen Nichts, in der gleichen Langsamkeit wie der Schnee im Titel, der allmählich in der Sonne schmilzt. Genau, der Titel: Wahrscheinlich ist es die suggestive Kraft dieses kurzen Titels, der bewirkt, dass wir uns trotz der zeichenhaft anmutenden Darstellung eine Kette von inneren Bildern ausmalen, die wie Schneeflocken aus den Wolken unseres Vorstellungsvermögens fallen. NACH DEM SCHNEE ist eine Angabe, die uns in einem Zeitkontinuum einen Platz zuweist und unseren Assoziationen Raum öffnet. Emotional gefärbte wie „ein langer Winter geht vorbei“ oder „endlich kommt der Frühling“. Und solche, die dem Bild eine Wertigkeit verleihen wie „was in Schweigen gehüllt war, wird nun ausgesprochen“ oder „Spuren im Schnee verschwinden“. Weil das Bild selber wie ein Wegweiser im eigenen Bildarchiv wirkt, mag man weiter an Joseph Beuys und sein Werk SCHNEEFALL (1965) im Museum für Gegenwartskunst in Basel denken. Quadratische Filzdecken, die auf drei astlosen, am Boden liegenden Fichtenstämmen lagern. Die einfache Kombination dieser Elemente wirkt als Auslöser für ein poetisches Bild: Wie eine zugleich schützende und begrabende Filzdecke legt sich der Filz über die entnadelten Fichtenstämme.
Eine letzte Bildbeschreibung. NACH DEM SCHNEE ist der Titel einer neuen Arbeit, die hier im Raum hängt: Das Bild zeigt einen liegenden Baumstamm, der aufs Äusserste reduziert dargestellt ist. Eine Umrisslinie markiert die obere Kante des Stamms, die untere Begrenzung ist nicht sichtbar. Einige stumpfe Äste ragen nach oben, blattlos und kahl wie die Knochen eines Gerippes. Linien im Innern verweisen auf die Struktur der Rinde. Ein kahler Baumstamm, der lange überwinterte im dicken Schneefell des Winters. So sparsam die zeichnerischen Indikatoren sind, so deutlich können wir die visuelle Sprache entziffern: Das ist ein Baumstamm. Seltsam unverortet liegt er im weissen Raum des Blattes. Dieses Weiss scheint unendlich zu sein, und es bedeutet vieles und nichts. Fast scheint es so, als ob sich der Baumstamm vor unseren Augen bewegte: Entweder er verschwindet oder er kommt langsam zum Vorschein aus dem weissen Nichts, in der gleichen Langsamkeit wie der Schnee im Titel, der allmählich in der Sonne schmilzt. Genau, der Titel: Wahrscheinlich ist es die suggestive Kraft dieses kurzen Titels, der bewirkt, dass wir uns trotz der zeichenhaft anmutenden Darstellung eine Kette von inneren Bildern ausmalen, die wie Schneeflocken aus den Wolken unseres Vorstellungsvermögens fallen. NACH DEM SCHNEE ist eine Angabe, die uns in einem Zeitkontinuum einen Platz zuweist und unseren Assoziationen Raum öffnet. Emotional gefärbte wie „ein langer Winter geht vorbei“ oder „endlich kommt der Frühling“. Und solche, die dem Bild eine Wertigkeit verleihen wie „was in Schweigen gehüllt war, wird nun ausgesprochen“ oder „Spuren im Schnee verschwinden“. Weil das Bild selber wie ein Wegweiser im eigenen Bildarchiv wirkt, mag man weiter an Joseph Beuys und sein Werk SCHNEEFALL (1965) im Museum für Gegenwartskunst in Basel denken. Quadratische Filzdecken, die auf drei astlosen, am Boden liegenden Fichtenstämmen lagern. Die einfache Kombination dieser Elemente wirkt als Auslöser für ein poetisches Bild: Wie eine zugleich schützende und begrabende Filzdecke legt sich der Filz über die entnadelten Fichtenstämme. Dann stellen sich wie in einem Schneesturm literarische Assoziationen ein. Ich denke an die Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel, die Geschichte der Bergleute von Falun, die er in „Unverhofftes Wiedersehen“ (1811) erzählt: Wie in Falun in Schweden zwei Junge Leute einander die Hochzeit versprachen. Dann aber kam der Verlobte nicht aus dem Bergwerk zurück, er galt als verschollen, und seine Braut weinte um ihn und vergass ihn nie. Als dann Bergleute 50 Jahre später einen Schacht gruben, kam im Schutt und im Vitrolwasser der Leichnam eines Jünglings zum Vorschein. Seine Gesichtszüge und sein Alter waren völlig unverändert und unverwest. Kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam; und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder und sprach: "Es ist mein Verlobter, um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte, und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende." Was lange unter einem kalten Mantel begraben war, kommt nun zum Vorschein. „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ ist der Titel eines Kriminalsromans des dänischen Schriftstellers Peter Hoeg, in dem die Protagonistin sich aufs Spurenlesen im Schnee verschrieben hat. Das erscheint mir zum Abschluss ein anderer treffender Vergleich zur künstlerischen Strategie von Susanne Fankhauser. Sie legt in ihren Bildern präzise Spuren aus, kleinste Zeichen in einem grossen Feld, die fast verwischt sind und schwierig zu lesen, die aber dem kundigen Betrachter verraten, welches Tier hier vorbeigegangen ist oder was an Bildzitaten zusammenkommt. Dies also die wilde Schneeschlacht, die um dieses so einfache Bild tobt.
Die Bilder von Susanne Fankhauser, und ich komme zum Schluss, sind knapper geworden, dadurch hat sich aber die Kommunikation untereinander verstärkt. Die Bilder hier in jedem Raum der Ausstellung sind zu stimmigen Anordnungen gruppiert, jedes Bild verkörpert eine Stimme, die in einer bestimmten Tonlage spricht: Sinnbildlich wie im Bild mit dem klingenden Titel DINGDONG, in dem die gespreizten Finger zweier Hände sachte eine Glocke halten, die an einer Schnur befestigt hin- und herschwingt.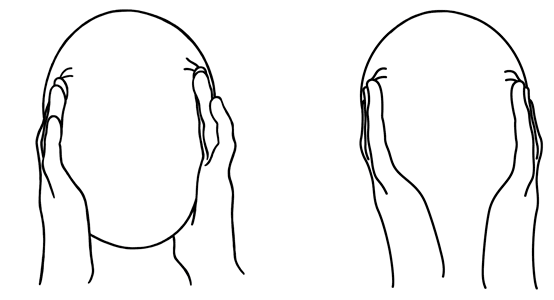
Und programmatisch wie in den Bildern KOPF I und KOPF II im Raum 4: Sie verbildlichen Stimmungslagen und zeugen davon, wie wenig es braucht, um einer extrem reduzierten Darstellung Bedeutung abzulesen. Der Umriss eines Gesichts, ein leeres Konterfei, Hände, die an die Schläfen gepresst werden: „Die Gesichter sind anonym, kein Strich charakterisiert eine wie auch immer geartete Gefühlsregung. Doch werden je nach Handhaltung und Neigungswinkel des Kopfs“ andere „Facetten des Bedeutungsspektrums wachgerufen: Konzentration oder Schmerz, Hilflosigkeit oder Begeisterung.“ Die Köpfe treten als „Formen der nichtsprachlichen oder vorsprachlichen Verständigung in Erscheinung“. Die Kunsthistorikerin Irene Müller spricht von solchen Bildern als „Pathosformeln“, Einheiten, die affektive Dimensionen genauso in sich einschliessen, wie sie auf kulturelle und soziale Praktiken verweisen und somit gleichzeitig den Charakter von Studien haben. Im Begriff „Pathosformel“ stossen Affekt und Strukturiertheit aufeinander.
In der Tat ein schönes Gleichnis, um die Erscheinungsweise der Bilder von Susanne Fankhauser zu benennen. Ein letzter Hinweis auf ein Bild soll meine Ausführungen abrunden: Präziser als im Bild LOVE (2007), das auf diesem Stockwerk den Auftakt bildet, könnte die Umarmung von Konzeptualismus und Sinnlichkeit, wie sie in den Bildern von Susanne Fankhauser geschieht, nicht zum Ausdruck kommen. So klar die konzeptuelle Spur der Werke ist, so vielschichtig ist die Wirkung der Bilder, ganz so, wie es Sol LeWitt im ersten Satz der Sentences of Conceptual Art beschrieben: „Konzeptuelle Künstler sind eher Mystiker als Rationalisten. Sie gelangen sprunghaft zu Lösungen, die der Logik verschlossen sind“. Mit diesem gewichtigen Zitat möchte ich schliessen und danke für die Aufmerksamkeit.